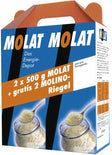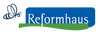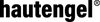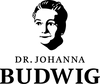Darm: Aufbau und Funktion des faszinierenden Verdauungsorgans
Plus 10 praktische Tipps für mehr Darmgesundheit

© mi-viri / gettyimages.de
Eigentlich denken wir nur über unseren Darm nach, wenn unsere Verdauung uns Probleme bereitet. Also, wenn uns beispielsweise Durchfall, Verstopfung oder Blähungen plagen. Sobald ein Magen-Darm-Infekt, ein Reizdarm oder auch eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung uns das Leben schwermachen, drängt sich der Darm schlagartig ins Bewusstsein. Läuft aber alles “wie geschmiert“, widmen wir diesem fleißigen Arbeiter keinerlei Beachtung. Das ist schade und auch grundverkehrt. Denn der Darm ist nicht nur ein super interessantes Power-Organ, sondern auch Sitz unseres Immunsystems.
Der Spruch: “Die Gesundheit eines Menschen liegt im Darm“ trifft zu. Schließlich fühlen wir uns nur dann gesund und rundum wohl, wenn es ihm gut geht. Denn dann ist auch das Immunsystem stark. Ist der Darm aber geschwächt, steht der Weg für viele Krankheiten offen. Schließlich ist dann auch das Immunsystem nicht mehr in der Lage, seinen vielen Aufgaben vollständig nachzukommen.
Zeit, dem Superorgan etwas Zeit zu widmen! Um besser zu verstehen, welche beeindruckenden Aufgaben es für Sie erfüllt – Tag für Tag, unermüdlich! Nach einem Überblick zu Aufbau und Funktion des Darms geben wir Ihnen noch ein paar praktische Tipps an die Hand, wie Sie Ihren Darm – und damit den Sitz Ihrer Gesundheit – stärken können.
Inhaltsverzeichniss
- Was ist der Darm?
- Wie lang ist der Darm?
- Aufbau des Darms
- Aufgaben des Darms
- Wenn der Darm nicht rund läuft: häufige Funktionsstörungen und Erkrankungen
- Darm: Welcher Arzt oder welche Ärztin kümmert sich um die Darmgesundheit?
- 10 Tipps für einen traumhaft gesunden Darm
Was ist der Darm?
Der Darm ist ein durchgehender Muskelschlauch, der am Magenausgang beginnt und sich bis zum After erstreckt. Er ist vielfach gewunden und befindet sich kompakt gefaltet im Bauchraum des Menschen. Die Hauptaufgabe des Darms besteht darin, unsere Nahrung zu verdauen und die zum Leben relevanten Nährstoffe aufzunehmen. Der Darm setzt sich grob gesagt aus zwei Teilen zusammen: dem Dünndarm und dem Dickdarm.
- nach oben
Wie lang ist der Darm?
Der Darm eines Erwachsenen hat – würde man ihn ausrollen – eine erstaunliche Länge von bis zu siebeneinhalb Metern. Davon entfallen bis zu sechs Meter auf den Dünndarm und etwa anderthalb Meter auf den Dickdarm. Verblüffend: Die Länge des Darms insgesamt entspricht in etwa der eines Wohnmobils.
- nach oben
Aufbau des Darms
Der Dünndarm, der einen deutlich kleineren Durchmesser hat als sein “dickerer Bruder“, setzt direkt am Magenausgang an. Der Dickdarm beginnt dort, wo der Dünndarm endet, und rahmt seinen “kleinen Bruder“ schützend ein. Dünndarm und Dickdarm bestehen selbst auch nochmal aus verschiedenen Abschnitten. Für eine gesunde Funktion des Darms sind etwa die Darmschleimhaut, die Darmzotten (fingerförmige Ausstülpungen), die Darmflora und die Verdauungssäfte von Leber, Bauchspeicheldrüse und anderen Drüsen essenziell.
Anatomie des Dünndarms
Der Dünndarm ist also der längste Teil des Verdauungskanals. Er setzt sich zusammen aus:
- Zwölffingerdarm (Duodenum)
- Leerdarm (Jejunum)
- Krummdarm (Ileum)
Der Zwölffingerdarm oder das Duodenum stellt den ersten Abschnitt des Dünndarms dar. Er ist etwa 30 Zentimeter lang. Darauf folgt der Leerdarm (Jejunum), der etwa zwei Meter in Anspruch nimmt. Der größte Teil des Dünndarms wird vom Krummdarm (Ileum) gebildet. Dieses Ileum ist etwa drei Meter lang.
Der Dünndarm schwebt aber nicht frei im Bauchraum, sondern wird von Gewebsfäden an der hinteren Bauchwand fixiert. Um die Nährstoffe im Dünndarm optimal aufnehmen zu können, ist die Dünndarmschleimhaut stark vergrößert. Sie besitzt zahlreiche Vertiefungen und zudem Zotten, fingerförmige Ausstülpungen, die die Oberfläche nochmals vergrößern. So stehen dem Dünndarm etwa 200 Quadratmeter Aufnahmefläche zur Verfügung. Der gesamte Darm hat Schätzungen zufolge eine Oberfläche von 250 bis 500 Quadratmeter. Dies entspricht in etwa der Größe eines Tennisplatzes.

Anatomie des Dickdarms
Der Dickdarm ist folgendermaßen aufgebaut:
- Blinddarm (mit Wurmfortsatz)
- Grimmdarm (Kolon)
- Mastdarm/ Enddarm (Rektum)
Der Dickdarm beginnt mit dem Blinddarm, der im rechten Unterbauch sitzt. Der Blinddarm heißt so, weil er nach unten hin recht schnell endet. Er hat einen dünnen Wurmfortsatz. Dieser und nicht der Blinddarm an sich, ruft die typischen Schmerzen bei einer Blinddarmentzündung hervor, weil er sich dabei entzündet. Dünndarm und Dickdarm sind durch die Ileozäkalklappe voneinander getrennt. Sie verhindert, dass der bakterienreiche Darminhalt des Dickdarms zurück in den keimarmen Dünndarm fließt und dient somit als wichtiger Schutzmechanismus der Verdauung.
Der Grimmdarm (Kolon), also das, was wir gemeinhin als Dickdarm bezeichnen, verläuft zunächst vertikal nach oben (aufsteigendes Kolon oder Colon ascendens), biegt dann scharf nach links ab, hängt girlandenartig (querverlaufendes Kolon oder Querkolon) über dem Dünndarm, ehe er auf der linken Bauchseite wieder steil nach unten abfällt (absteigendes Kolon oder Colon descendens). Dann wird der Dickdarm zum S-förmig gebogenen Sigma-Kolon (Colon sigmoideum), das schließlich in den Mastdarm, auch bekannt als Enddarm, mündet.
- nach oben
Aufgaben des Darms
Die Aufgaben des Darms sind ebenso faszinierend wie der Aufbau des Organs. Jeder Abschnitt hat seine speziellen Aufgaben. Alles in allem ein ausgeklügeltes, intelligentes System, das menschliches (und auch tierisches) Leben überhaupt erst ermöglicht. Hier ein kurzer Überblick über die Funktionen des Darms:
- Zerlegung der Nahrung
- Aufnahme von Nährstoffen aus dem Speisebrei und Weitergabe der Nährstoffe ins Blut
- Weitertransport des Speisebreis durch den Verdauungskanal
- Abtransport unnützer Stoffe aus dem Körper (Eindickung des Speisebreis = Stuhlproduktion)
- Regulation des Wasserhaushalts: Aufnahme und Ausscheidung von Wasser
- Abwehr von Krankheitserregern (im Darm sitzt ein großer Teil unseres Immunsystem)
- Darmbakterien: unter anderem die Herstellung von bestimmten Vitaminen und kurzkettigen Fettsäuren, die die Darmschleimhaut gesund halten und ernähren
Funktion des Dünndarms – verwertbare Nährstoffe aus der Nahrung
Im Dünndarm wird die hauptsächliche Verdauungsarbeit geleistet. Denn hier werden die Nährstoffe, die wir zum Leben brauchen, zerlegt, herausgefiltert und ans Blut abgegeben.
Zwölffingerdarm (Duodenum) – die Enzyme kommen ins Spiel
Im Duodenum werden wichtige Vorbereitungen zur weiteren Verdauung getroffen. Auch werden hier diverse Hormone gebildet und wichtige Enzyme eingespeist. In den Zwölffingerdarm fließt das Verdauungssekret der Leber – also die Galle, die in der Gallenblase gespeichert wird – und das Sekret der Bauchspeicheldrüse. Dazu gesellt sich noch das Sekret der Duodenaldrüsen (Brunner-Drüsen). Alle diese Sekrete mit ihren Enzymen werden im Duodenum und darüber hinaus zur Verdauung der aufgenommenen Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße benötigt.
Die Brunner-Drüsen bilden gemeinsam mit der Bauchspeicheldrüse zusätzlich einen alkalisch wirkenden Schleim, der Bikarbonat enthält. Damit kann der stark saure Nahrungsbrei aus dem Magen rasch neutralisiert werden und die Verdauungsenzyme können mit ihrer Arbeit beginnen.
Damit die Verdauungssäfte auch bereitstehen, wenn sie gebraucht werden, gibt es spezielle Hormone. Das Hormon Gastrin beispielsweise fördert die Freisetzung von Bauchspeicheldrüsensekret. Das Hormon Cholezystokinin wiederum ist für die Ausschüttung von Pankreasenzymen und Gallensäuren zur Fettverdauung zuständig. Das Hormon Sekretin steuert die Bikarbonatproduktion.
Leerdarm (Jejunum) – Zerlegung und Aufnahme essenzieller Nährstoffe
Das Jejunum führt die Verdauungsarbeit fort. Der Leerdarm nimmt zusammen mit dem Krummdarm die meisten Nährstoffe auf. Im Jejunum wird unsere Nahrung mithilfe der Verdauungsenzyme aufgespalten. Dabei entstehen die Grundbausteine unserer Nahrung: Einfachzucker aus Kohlenhydraten, Aminosäuren aus Eiweißen sowie Fettsäuren aus Fetten. Diese werden gemeinsam mit dem Wasser, den Vitaminen und Mineralsalzen über die Darmschleimhaut aufgenommen.
Um den Nahrungsbrei weiterzuleiten, zieht sich die Muskulatur der Jejunum-Wand rhythmisch zusammen. Dabei wird der Darminhalt durch die Bewegungen vermischt, damit die Verdauungsenzyme auch überall hingelangen. Zugleich wird der Darm durch den Schleim, den die Becherzellen in der Darmschleimhaut bilden, vor der Zerstörung durch die aggressive Magensäure bewahrt.
Krummdarm (Ileum) – nährstoffreiche Flüssigkeit ermöglicht Leben
Im Ileum wird der Nahrungsbrei mithilfe der Verdauungsenzyme weiter zerlegt. Unterstützend wirken hier auch Sekrete, die aus Darm-Drüsen stammen, die über den gesamten Dünndarm verteilt sind. Der Speisebrei ist im Ileum sehr dünnflüssig. Das liegt an den vielen Verdauungssäften und dem Wasser im Schleim, die auf dem Weg hierher dem Nahrungsbrei zugesetzt wurden.
Darmwand und Darmschleimhaut (Mukosa) des Dünndarms – Nährstoffaufnahme und Zentrum des Immunsystems
Die Darmschleimhaut bildet die innere Auskleidung des Darms. Es ist also die Schicht der Darmwand, die man sähe, würde man eine Reise durch den Darm unternehmen. Sie wird gebildet durch eine Schicht mit Epithelzellen und ihren Anhängseln, den Darmzotten. Darunter besteht die Darmwand aus einer Bindegewebsschicht mit Blut- und Lymphgefäßen sowie Nerven. Im Anschluss folgt eine zweigeteilte Muskelschicht, die den Nahrungsbrei durch Kontraktionen weiterleitet.
Die Oberfläche der Darmschleimhaut ist zum Zweck der optimalen Nährstoffaufnahme (Resorption) stark zerklüftet und aufgefaltet. So ragen die sogenannten Kerckring-Falten (die Ausstülpungen) bis zu einem Zentimeter hoch auf. Zusätzlich tragen die winzigen Darmzotten (Mikrovilli) und die Einsenkungen (Krypten) zu einer vergrößerten Darmoberfläche bei. Die Darmzotten sind kleine, fingerartige Ausstülpungen, die sowohl auf den Kerckring-Falten als auch der restlichen Darmschleimhaut zu finden sind.
Neben der Aufnahme von Nährstoffen erfüllt die Darmwand wichtige Aufgaben des Immunsystems. Die Epithelzellen der Schleimhaut fungieren etwa als Pförtner. Dies sind die Zellen, die entscheiden, welche Stoffe in den Körper gelangen dürfen und welche nicht. Getreu dem Motto: Nährstoffe sind willkommen, Krankheitserreger, Allergene oder Toxine müssen draußen bleiben.
Eine Ebene tiefer, in der Darmwand, warten schon etliche Immunzellen darauf, potenzielle “Schädlinge“, also Viren oder Bakterien, zu erkennen und Alarm zu schlagen. Denn hier sitzt der größte Teil der menschlichen Abwehrzellen. Kein Wunder! Schließlich werden auch viele Keime mit heruntergeschluckt und landen letztlich im Darm. Und dann müssen die Darmschleimhautzellen als Wächter unserer Gesundheit darüber entscheiden, ob die vorhandenen Stoffe in den Körper hineingelangen dürfen oder eben bekämpft werden müssen. Hier schaltet das darmassoziierte Immunsystem also bereits viele Erreger aus.
Die Epithelzellen können aber noch mehr: Sie sind Botschafter, die zwischen dem Immunsystem und den Darmbakterien vermitteln. So empfangen sie Signale des Immunsystems und können so Veränderungen in der Darmflora anregen. Zudem kommen auch Botschaften der Darmbakterien bei den Epithelzellen an, die dann wiederum das Immunsystem zu bestimmten Aktionen veranlassen können. In dem großen Zahnrad “Immunsystem“ greifen also viele kleine Rädchen perfekt ineinander.
“Bauchhirn an Kopfhirn“ – die Darm-Hirn-Achse
Über die Darm-Hirn-Achse stehen Darm und Gehirn stets in Verbindung. Man kann sagen, dass durch ein gigantisches Nervengeflecht mit Millionen Neuronen, aber auch Hormonen, Neurotransmittern und Darmbakterien ein “heißer Draht“ zwischen beiden Parteien besteht. Kein Wunder, dass man bei einer riskanten Entscheidung schon mal Bauchschmerzen bekommt.
Doch der hauptsächliche Informationsfluss läuft nicht – wie man vielleicht erwarten würde – vom Gehirn zum Bauch, sondern vom Bauch zum Gehirn. Also scheint das Bauchhirn den Ton in dieser Beziehung anzugeben. Der Bauch grummelt, wenn wir Angst oder Stress haben, oder glüht förmlich, wenn wir verliebt sind. Forscher gehen inzwischen davon aus, dass der Darm und sein Gesundheitszustand unsere Gedanken, Gefühle und unsere allgemeine Gesundheit ganz entscheidend mitbestimmt.
Funktion des Dickdarms
Der Dickdarm ist für die Weiterleitung der vom Körper nicht benötigten Stoffe verantwortlich. Auf seiner Reise durch den Dickdarm wird der Speisebrei zum Stuhl (Kot), indem ihm Wasser und Elektrolyte (Natrium, Kalium, und weitere) entzogen werden. Im Dickdarm lebt eine gigantische Mikrobengemeinschaft, die die Ballaststoffe – also eigentlich unverdauliche Pflanzenbestandteile – verdaut. Die Muskeln des Dickdarms ziehen sich immer wieder rhythmisch zusammen (Peristaltik), wodurch der Speisebrei beziehungsweise später der Stuhl durch die verschiedenen Dickdarmabschnitte in Richtung Anus befördert wird.
Blinddarm – von wegen überflüssig!
Der Dickdarm beginnt mit dem kleinsten Abschnitt, dem Blinddarm. Zwischen dem Blinddarm und dem dann folgenden Grimmdarm liegt die Ileozäkalklappe. Diese trennt Dünn- und Dickdarm voneinander. So wird verhindert, dass der Brei – einmal im Dickdarm angekommen – wieder zurück in den Dünndarm fließt. Andersherum kann sie sich aber öffnen, um den Speisebrei den Dickdarm passieren zu lassen.
Lange wurde angenommen, der Blinddarm habe keine besondere Funktion. Inzwischen ist bekannt, dass der Blinddarm beispielsweise ein wichtiges Rückzugsgebiet für gute Darmbakterien ist, die sich um die Verdauung von Ballaststoffen (also faserigen Pflanzenteilen) kümmern. Ist die Darmflora durch Antibiotika-Einnahme oder einen Infekt stark dezimiert, überleben die Bakterien im Blinddarm. So kann von hier aus die Wiederbesiedlung des Dickdarms starten. Zudem spielt der Blinddarm eine große Rolle bei der Immunabwehr, denn seine Wand besteht größtenteils aus lymphatischem Gewebe. Hier bilden sich im Falle des Eindringens von Krankheitserregern viele Abwehrzellen aus, die diese dann bekämpfen. Auch wird hier weiterer Schleim produziert, der sicherstellt, dass der Brei weiter transportiert werden kann.
Grimmdarm – erwünschter Wasserdieb und Hauptsitz unserer Darmflora
Der längste Teil des Dickdarms ist der Grimmdarm (Kolon). Er ist hauptsächlich dafür zuständig, dem Darminhalt Wasser zu entziehen, das der Körper dringend benötigt. Außerdem nimmt er lebenswichtige Elektrolyte wie Kalium, Magnesium oder Chlorid auf. So zieht der Grimmdarm pro Tag etwa einen Liter Wasser aus dem Nahrungsbrei auf seinem Weg zum Ausgang. Der Grimmdarm führt mithilfe der Muskelschicht Transport- und Mischbewegungen aus. Erstere dienen dazu, den Darminhalt in Richtung Anus zu befördern. Letztere sind dazu da, den Brei zu vermischen, um die Wiederaufnahme bestimmter Stoffe zu gewährleisten.
Überall im Darm, vor allem aber im Dickdarm, finden sich unzählige Bakterien. Im gesamten Darm können es bis zu 100 Billionen sein. Die Darmbewohner nehmen in unserem Körper und in unserem Immunsystem viele wichtige Aufgaben wahr. Deshalb wird die Darmflora inzwischen auch oft als “Organ im Organ“ bezeichnet. Der Dünndarm ist im Vergleich zum Dickdarm eher spärlich mit Bakterien besiedelt. Auch ist die Darmflora dort anders zusammengesetzt. Doch im Dickdarm – und hier vor allem im Grimmdarm – tummeln sich die Bakterien in unvorstellbaren Dimensionen.
Die Milchsäurebakterien sind eine besonders wertvolle Spezies der Dickdarmflora. Diese Bakterien bauen hauptsächlich die unverdaulichen Ballaststoffe in pflanzlicher Nahrung ab. Dabei entstehen wertvolle kurzkettige Fettsäuren. Diese dienen den Darmschleimhautzellen als Futter und halten die Darmschleimhaut somit gesund und funktionsfähig. Bestimmte Dickdarmbewohner sind auch an der Herstellung von Vitamin K oder den B-Vitaminen beteiligt sowie an der Bildung von wichtigen Hirnbotenstoffen wie GABA (Gamma-Aminobuttersäure) oder dem Glückshormon Serotonin.
Eine gesunde Darmflora weist eine große Vielfalt an Arten auf und hat die richtige Balance zwischen “guten“ Bakterien und potenziell krankmachenden Bakterien. Sind die guten Bakterien zahlreich vertreten, haben sie die Vorherrschaft im Darm. Dann können sie in der Regel verhindern, dass die krankmachenden Mikroben sich vermehren und eine Infektion auslösen.
Zwischen dem Mikrobiom im Darm und den Immunzellen besteht eine rege Kommunikation. Bestimmte Bakterien sind etwa daran beteiligt, dass unser Immunsystem angemessen reagiert. Sie informieren die regulatorischen T-Zellen, sodass das Immunsystem nicht auf harmlose Stoffe (wie bei einer Allergie) oder gar auf Teile des eigenen Körpers reagiert (wie bei einer Autoimmunreaktion). So ist das Mikrobiom im Darm von zentraler Bedeutung für unsere Gesundheit.
Mastdarm (Rektum) – Endstation der Verdauung
Der Mastdarm ist der letzte Abschnitt des Dickdarms. Anders als sein Name vermuten lässt, verläuft das Rektum oder auch der Enddarm, nicht kerzengerade, sondern in zwei Krümmungen. Landet der Darminhalt hier, hat er sich bereits in jenen Stuhl verwandelt, der dann über den Analkanal ausgeschieden wird. Das Rektum dient also der Aufbewahrung des Stuhls. Bis zu 20 Stunden kann der Kot hier zwischengelagert werden. Sobald sich Stuhl im Mastdarm befindet, wird der Stuhldrang ausgelöst. Aufhalten lässt sich die Darmentleerung noch für einige Zeit dank des Anus-Schließmuskels und eines festen Willens. Schließlich ist nicht immer eine Toilette zugegen. Gleitfähig ist der Stuhl im Mastdarm, weil auch hier die Darmwand entsprechenden Schleim freisetzt.
Dickdarmschleimhaut
Die Schleimhaut des Dickdarms hat, anders als die des Dünndarms, fast keine Darmzotten mehr. Lediglich die Krypten, also die Vertiefungen, kommen im Dickdarm häufig vor. Hier sitzen die Becherzellen, die den Schleim absondern, der benötigt wird, um den Stuhl geschmeidig weiterzuleiten. Die Epithelzellen der Dickdarmschleimhaut entziehen dem Stuhl Wasser und nehmen Elektrolyte auf. Diese regeln neben dem Wasserhaushalt auch den Säure-Basen-Haushalt sowie die Muskel- und Nervenfunktion.
Dickdarmwand: von Muskeln und Ausbuchtungen
Um den Darminhalt weiterzuleiten, gibt es in der Darmwand eine längs- und querverlaufende Muskelschicht. Die längsverlaufende Muskelschicht wird an drei verschiedenen Stellen des Dickdarms von verstärkenden Strängen unterstützt. Diese werden Tänien genannt.
Als Haustren bezeichnet man die deutlich sichtbaren Ausbuchtungen des Kolons. Sie entstehen zum einen dadurch, dass die Tänien etwas kürzer sind als die restliche Darmwand und diese dadurch so zusammengeschoben wird wie eine geraffte Gardine. Zum anderen bilden sie sich aber auch, weil die querverlaufende Ringmuskelschicht die Darmwand in regelmäßigen Abschnitten “eingeschnürt”.
Stuhlgang – Spiegel der Darmgesundheit
Der ideale Stuhl ist braun, geschmeidig und dennoch deutlich geformt. Er besteht aus einer einheitlichen, zusammenhängenden Masse, die möglichst keine Risse zeigt. Bei einer gesunden Verdauung lässt sich der Stuhl leicht ausscheiden. Er sollte nicht zu fest und nicht zu weich sein. Ist er breiig, zähflüssig oder wässrig, handelt es sich um Durchfall. Dann liegt vielleicht eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, eine Infektion mit einem Virus oder eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung vor. Bei Verstopfung (Obstipation) bilden sich meist harte Klümpchen, die nur unter großer Anstrengung auszuscheiden sind. Den Darm zu entleeren, kann damit zu einer qualvollen Angelegenheit werden. Alternativ weist der Stuhl bei Verstopfung zwar eine Wurstform auf, ist aber dennoch von klumpiger Konsistenz.
Im Idealfall riecht der ausgeschiedene Kot “aromatisch”, das heißt, zwar intensiv, aber weder sauer noch nach faulen Eiern. Schwefelreiche Lebensmittel wie Milchprodukte, Fleisch oder Kohl können einen fauligen Geruch auslösen. Ein Schwefelgeruch weist auf Fäulnisprozesse im Darm hin. Sauer riechender Stuhl hingegen kann ein Anzeichen für eine Fettverdauungsstörung oder einen zu sauren pH-Wert im Darm sein. Er entsteht durch vermehrte Gärungsvorgänge im Darm. Auch eine Glutenunverträglichkeit oder Morbus Crohn können zu einem sauren Stuhl führen.
Bei der Häufigkeit der Darmentleerung gilt dreimal täglich bis zu dreimal wöchentlich als normal. Durchschnittlich bildet der menschliche Darm 128 Gramm Stuhl pro Tag. Beim Verzehr vieler Ballaststoffe im Rahmen einer vollwertigen Kost kann es aber mehr sein.
- nach oben
Wenn der Darm nicht rund läuft: häufige Funktionsstörungen und Erkrankungen
Viele Menschen haben heutzutage Probleme mit dem Darm. Dafür sind oft unser moderner Lebensstil und unsere Ernährungsgewohnheiten verantwortlich. Dann kann der Darm folgende Beschwerden oder Erkrankungen entwickeln:
- Verstopfung (Obstipation)
- Durchfall (Diarrhoe)
- Blähungen
- Bauchschmerzen oder Krämpfe
- Reizdarm
- chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn
- Leaky gut (durchlässiger Darm)
- Gestörte Zusammensetzung der Darmflora
- Aber auch allgemeine Beschwerden wie: Müdigkeit, Erschöpfung, depressive Verstimmungen, Konzentrationsprobleme (Brain Fog), Vitalstoffmängel (Vitamin B12, D, Eisen)
- Darmgeschwüre
- Darmkrebs
- viele weitere Erkrankungen
- nach oben
Darm: Welcher Arzt oder welche Ärztin kümmert sich um die Darmgesundheit?
Bei Beschwerden des Darms wie Schmerzen oder Verdauungsstörungen ist es empfehlenswert, sie in einer gastroenterologischen Praxis abklären zu lassen. Denn diese Fachärzt:innen verfügen über die entsprechenden Gerätschaften, mit denen sie den Gesundheitszustand Ihres Darms feststellen können. So stehen in einer gastroenterologischen Praxis beispielsweise Ultraschall, Labortests sowie die Darmspiegelung (Endoskopie) zur Abklärung von Symptomen wie Verstopfung, Durchfall, Unterleibsschmerzen, einem Blähbauch oder Blut im Stuhl zur Verfügung.
- nach oben
10 Tipps für einen traumhaft gesunden Darm
Einen gesunden Darm – wer wünscht sich das nicht? Dabei ist es gar nicht so schwer, im Alltag etwas für die eigene Darmgesundheit zu tun. Wie immer – wenn es um Gesundheit geht – liegt ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der Ernährung. Aber auch in Sachen Bewegung und Schlaf kann vielleicht noch etwas nachjustiert und “darmfreundlicher“ gestaltet werden.
1. Ernähren Sie sich pflanzenbasiert
Der Darm sehnt sich nach einer gesunden, ballaststoffreichen Kost, die überwiegend pflanzenbasiert ist. Greifen Sie daher zu reichlich Gemüse, Hülsenfrüchten und Obst. Bringen Sie auch täglich Vollkornprodukte, Samen (Leinsamen und Flohsamen sind besonders empfehlenswert für den Darm), Nüsse sowie pflanzliche Öle auf den Tisch. Und wenn Sie sich nicht vegan oder vegetarisch ernähren: Gehen Sie zurückhaltend mit tierischen Produkten wie Käse oder Eiern um. Fleisch und Fisch können ein- bis zweimal pro Woche auf dem Teller landen.
Die Vielfalt der Darmbakterien und die Vermehrung der guten Mikroben lassen sich fördern, indem Sie mehr als 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche essen und – wenn möglich – viele davon in Bio-Qualität einkaufen.
2. Essen Sie fermentierte Lebensmittel
Joghurt ohne Zucker (Naturjoghurt), Buttermilch oder Kefir – Was haben all diese Milchprodukte gemeinsam? Richtig! Probiotika. Das sind lebende Mikroorganismen, die sich im Darm ansiedeln und vermehren können. Ebenso probiotisch wirken selbstgemachtes Sauerkraut, Apfelessig, Kombucha, Miso und Kimchi. Mit einer probiotischen Kost können Sie eine veränderte Darmflora positiv beeinflussen. So lässt sich damit etwa auch einer Überwucherung mit dem Pilz Candida albicans entgegenwirken. Dieser kann sich durch Beschwerden wie Juckreiz am After sowie Verdauungsprobleme bemerkbar machen.
3. Reduzieren Sie Darm-Krankmacher
Zu den Lebensmitteln, die unserem Darm drastisch zusetzen, gehören neben Zucker Weißmehlprodukte, Fast Food, Alkohol, zu viel Fleisch, Gepökeltes und Fertiggerichte. Das sind die absoluten Feinde Ihrer Darmbakterien. Daher sollten Sie mit diesen Lebensmitteln bewusst umgehen. Versuchen Sie außerdem, so viel Sie können, in Bio-Qualität einzukaufen. Denn die Reste der Pflanzenschutzmittel in konventionell erzeugten Produkten machen nicht nur “Schädlingen“, sondern auch Ihren Darmbakterien zu schaffen. Wenn Sie rauchen: Stellen Sie das Rauchen besser ein. Denn die vielen enthaltenen Toxine schaden nicht nur Ihrem Darm. Die Hypnotherapie ist hier eine erfolgversprechende Therapieform.
Versuchen Sie auch, Fleisch und Käse zu reduzieren. Denn: Bei zu proteinhaltiger Ernährung werden im Darm vermehrt Gase frei (Gärung), die ein ungünstiges Milieu im Darm schaffen. Denn in einem solch alkalischen Umfeld fühlen sich die gesundheitsfördernden Milchsäurebakterien nicht sonderlich wohl. Dafür gedeihen die schlechten Mikroorganismen umso prächtiger. Und das gilt es ja zu verhindern.
Immer mehr Menschen vertragen auch bestimmte Nahrungsmittel nicht. Dazu gehören Laktose (Milchzucker), Gluten (Klebereiweiß), histaminreiche Lebensmittel oder Fruktose (Fruchtzucker). Wenn Sie häufig Bauchbeschwerden haben, lassen Sie sich in einer Praxis für Gastroenterologie einmal gründlich untersuchen. Vielleicht ist es notwendig, bestimmte Lebensmittel zu meiden oder die Ernährung umzustellen.
4. Ein Glas Wein – darf’s schon mal sein!
Zum Thema Alkohol: Es schadet nicht unbedingt, hin und wieder ein Glas Wein zu trinken. Einmal pro Woche ein Glas Rotwein zu trinken, fördert laut Studien sogar eine gesunde Darmflora. So nimmt durch moderaten Rotweinkonsum sowohl die Artenvielfalt als auch die Zahl der guten Bakterien zu. Um diesen erstaunlichen Effekt auf den Darm zu erzielen, reicht schon ein Glas Rotwein in 14 Tagen aus.
5. Präbiotische Stoffe sind gut für den Darm
Präbiotische Lebensmittel enthalten besonders viele Ballaststoffe, die unser Mikrobiom gedeihen lassen, da sich dieses zum Teil von diesen Fasern ernährt. Besonders ballaststoffreich sind Topinambur, Chicorée, Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Topinambur, Schwarzwurzeln, Artischocken und Bananen.
6. Trinken Sie ausreichend
Versuchen Sie, über den Tag verteilt, etwa anderthalb bis zwei Liter Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken. Denn nehmen Sie reichlich Wasser auf, können Schadstoffe besser ausgeschieden werden, sodass Ihr Darm nicht so arg belastet wird. Auch benötigt der Darm genügend Wasser, um einem zu festen Stuhl (Verstopfung) vorzubeugen.
7. Stärken Sie Ihren Darm mit genügend Schlaf
Hätten Sie gedacht, dass Sie mit einem guten und ausreichenden Schlaf etwas für Ihre Darmgesundheit tun können? Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass eine ausreichende Schlafdauer von siebeneinhalb Stunden und eine gute Schlafqualität Ihre Darmflora stärkt. Zudem findet im Schlaf, von allem im Tiefschlaf, die Reparatur und Neubildung von Zellen statt, die unerlässlich sind, um den Darm gesund zu halten. So werden auch die Immunzellen im Darm gestärkt, was wiederum ein leistungsfähiges Immunsystem fördert. Mit einem Schlaftracker können Sie zumindest Hinweise bekommen, ob Ihre Tiefschlafdauer ausreicht oder nicht. Viele Menschen, gerade die, die viel Stress haben, erreichen oft nur noch wenige Minuten Tiefschlaf pro Nacht statt der erforderlichen anderthalb Stunden.
8. Treiben Sie regelmäßig Sport
Wenn Sie pro Woche mindestens zweimal für eine halbe Stunde Ausdauersport treiben, haben Sie schon viel für Ihren Darm getan. Denn mit der Bewegung kurbeln Sie nicht nur Ihren Stoffwechsel an. Sie vermehren damit auch Ihre Abwehrzellen, Ihre guten Darmbakterien und reduzieren Entzündungen im Körper. Prima eignen sich dazu Walken, Joggen, Schwimmen oder Radfahren – aber natürlich auch jede andere Sportart, die Sie mit viel Begeisterung ausüben.
9. Nehmen Sie Antibiotika mit Bedacht
Antibiotika sollten nur dann eingenommen werden, wenn es aus medizinischer Sicht notwendig ist. Bei viralen Infekten sind sie meist nicht sinnvoll, da sich Antibiotika gegen Bakterien und nicht gegen Viren richten. Vergessen Sie nicht, Ihren Darm nach Antibiotika-Einnahme wieder aufzubauen. Dazu empfehlen wir Ihnen, reichlich präbiotische und probiotische Lebensmittel zu essen sowie für drei Monate ein entsprechendes probiotisches Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen.
10. Reduzieren Sie Stress
Anhaltender seelischer Stress ist Gift für den Darm. Dabei ist es egal, ob eine unglückliche Partnerschaft, ein unausstehlicher Chef, Termindruck oder Einsamkeit dahinterstecken. Negative Emotionen und das Gefühl von Zeitnot hinterlassen beim Menschen auf Dauer Spuren – psychische oder körperliche – aber immer Spuren. Daher versuchen Sie, Stress zu reduzieren, wo immer es geht. Verharren Sie nicht für längere Zeit in negativen Gedanken oder Gefühlen wie Ärger oder Frust. Richten Sie Ihre Gedanken bewusst auf schöne Dinge, denn positive Gedanken und Gefühle stärken nicht nur Ihre Psyche, sondern auch Ihren Darm.
Bei Unruhe und Schlafproblemen kann es in jedem Fall helfen, eine Entspannungstechnik wie die progressive Muskelentspannung oder Yoga zu erlernen. Denn praktiziert man eine solche Methode regelmäßig, erlangt man einen viel tieferen Entspannungszustand. Dieser tiefenentspannte Zustand wirkt sich dann wiederum positiv auf die Darmgesundheit aus.
Vielen Menschen gelingt es heute gar nicht mehr, in den Entspannungsmodus (in dem der Parasympathikus das Ruder im Nervensystem übernimmt) zu wechseln. Daher fehlt dem Körper heute oft die Basis, um all die notwendigen Regenerationsarbeiten vollständig ausführen zu können. Gepaart mit etwaigen Schlafproblemen ist dies eine echte Gefahr für die (Darm-)Gesundheit. Weit verbreitete Folgen davon: chronische Erschöpfung, Leistungsminderung – und eben auch Verdauungsprobleme.
Spannende Fakten zum Darm im Überblick
- Der Darm ist bis zu siebeneinhalb Meter lang, also etwa so lang wie ein Wohnmobil.
- Die Oberfläche des Darms ist schätzungsweise so groß wie ein Tennisfeld.
- Der Darm wird auch als “zweites Gehirn“ bezeichnet und gilt als Sitz der Intuition. Daher sprechen wir auch vom “Bauchgefühl“, wenn wir etwas “wissen“, aber eben nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Bauchhirn.
- Das Bauchhirn mit seinen 100 Millionen Nervenzellen leitet die wahrgenommenen Empfindungen und Eindrücke ans Gehirn weiter.
- Der Informationsaustausch findet hauptsächlich vom Darm zum Gehirn statt, nicht etwa andersherum. Das Bauchhirn scheint also in dieser Beziehung der Taktgeber zu sein.
- Der Nahrungsbrei kann bis zu 150 Stunden durch den menschlichen Verdauungstrakt reisen. Die meiste Zeit verbringt er davon aber als Kot im letzten Darmabschnitt, dem Mastdarm.
- 70 Prozent der Immunzellen sitzen in der Darmwand, damit ist der Darm der zentrale Sitz unseres Immunsystems.
- 1000 verschiedene Bakterienarten und bis zu 100 Billionen Bakterien sollen schätzungsweise im Darm leben. Das sind zehnmal mehr, als es menschliche Zellen im Körper gibt.
- Würde man die Mikroorganismen im menschlichen Darm auf eine Waage legen, würden sie zusammen etwa zwei Kilogramm wiegen (also so viel wie zwei Päckchen Mehl).
- Im Darm werden unter anderem die Glückshormone Serotonin und Dopamin sowie das Schlafhormon Melatonin gebildet. Aber auch GABA, ein beruhigend wirkender Neurotransmitter, entsteht hier.
- Forscher gehen davon aus, dass je vielfältiger wir essen (also hauptsächlich viele unterschiedliche Pflanzenarten), desto artenreicher ist unsere Mikroflora und desto gesünder ist der Darm und damit der Mensch.
- nach oben
Reformhaus® Produktempfehlungen rund um das Thema Verdauung
Hier finden Sie all unsere Produkte zum Thema Magen und Darm
Produkte für Magen und DarmMikrobiom des Darms – Das sollten Sie wissen
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie das Mikrobiom im Darm Ihre Verdauung, das Immunsystem und sogar Ihre Psyche beeinflusst – und was Sie selbst tun können, um Ihre Darmflora ins Gleichgewicht zu bringen. Von den Grundlagen über Dysbiose bis zu praktischen Tipps wie Ernährung, Probiotika & Lebensstil. ⇒ Jetzt lesen, um mehr zu wissen.
Mikrobiom
Lassen Sie sich persönlich in Ihrem Reformhaus® vor Ort beraten
Durch unser geschultes Fachpersonal können wir Ihnen eine ausgiebige Beratung anbieten und ganz auf Ihre Bedürfnisse eingehen.
Finden Sie ein Reformhaus® in Ihrer Nähe
Autor:in: Redaktion